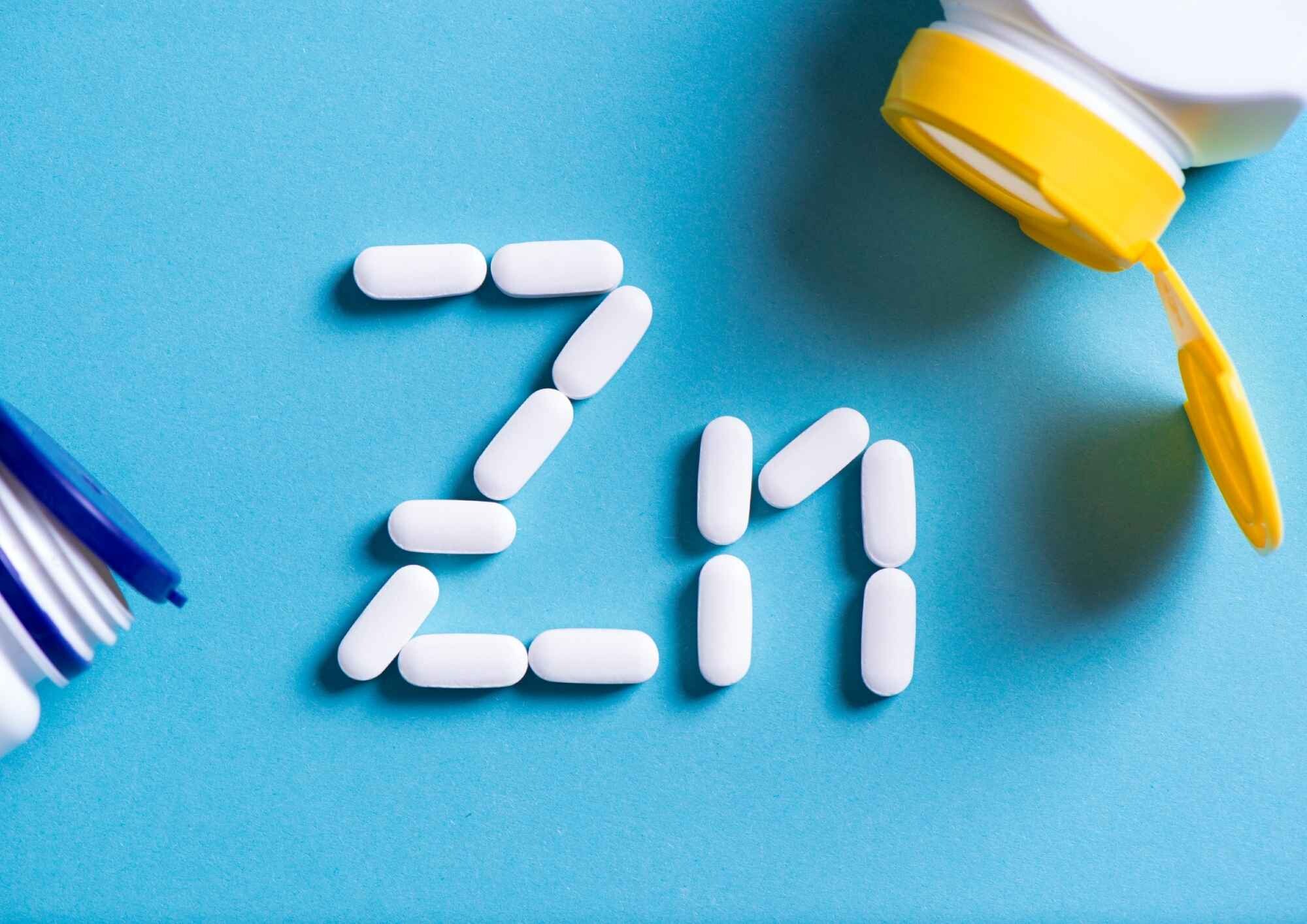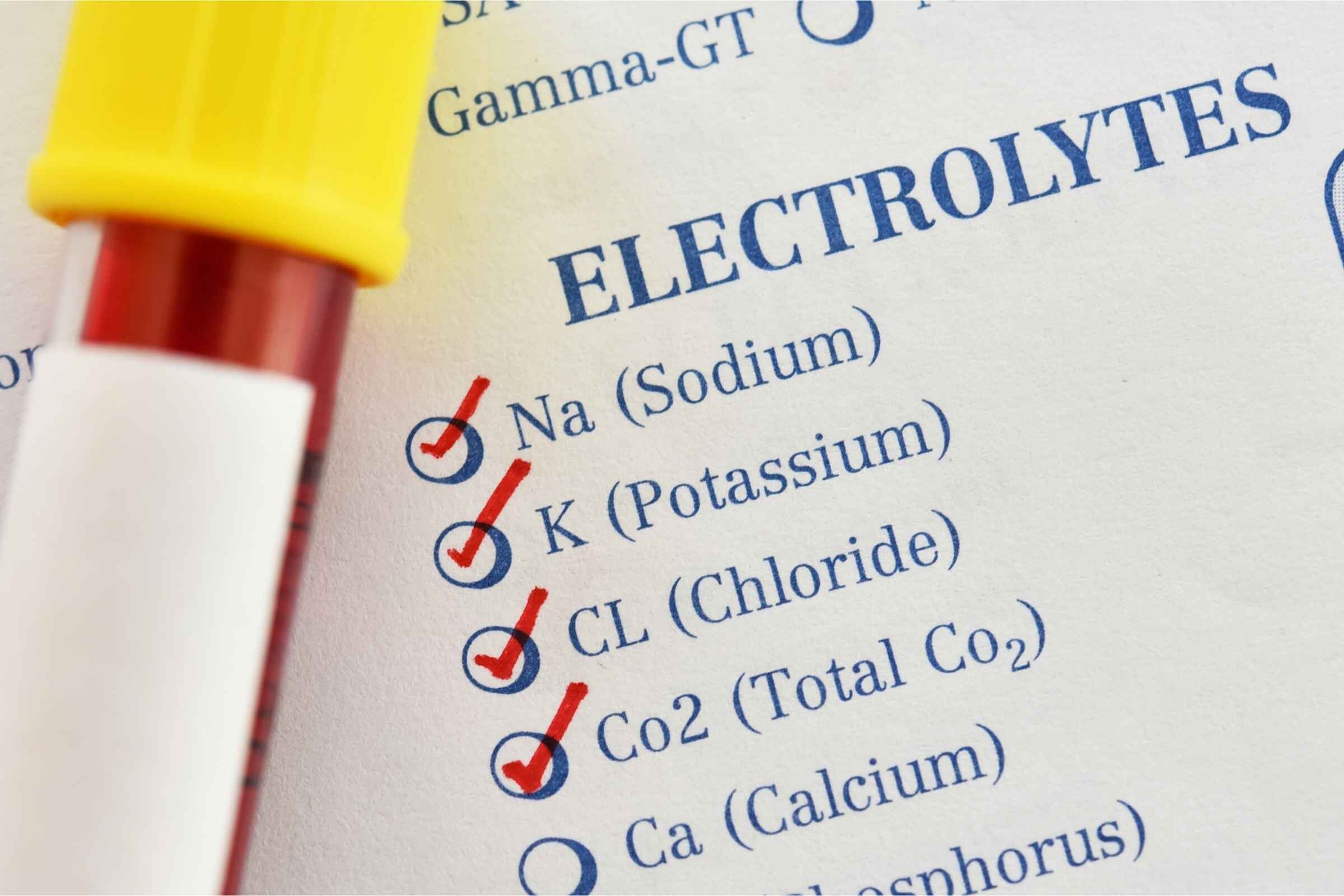Table of contents
- Einleitung: Allergien auf dem Vormarsch
- Allergien in Deutschland – Zahlen und Trends
- Formen von Allergien: Von Pollen bis Tierhaaren
- Ursachen und Risikofaktoren
- Symptome und Auswirkungen auf die Lebensqualität
- Schulmedizinische Behandlungsmöglichkeiten
- Alternative und komplementäre Ansätze
- Prävention und Tipps für Allergiker
Einleitung: Allergien auf dem Vormarsch
Allergische Erkrankungen gehören in Deutschland zu den häufigsten Gesundheitsproblemen und nehmen seit Jahrzehnten zu. Schätzungen zufolge leidet etwa jeder dritte Erwachsene hierzulande an einer Allergie – das entspricht über 21 Millionen Betroffenen. Rechnet man Kinder und Jugendliche mit ein, kommt man auf insgesamt mehr als 23 Millionen Allergiker in Deutschland. Allergien sind damit längst eine Volkskrankheit. Besonders verbreitet ist der Heuschnupfen, also die Pollenallergie: Etwa 15 % der Erwachsenen haben eine Pollenallergie, was diese zur häufigsten Einzel-Allergie macht. Allergien sind nicht nur lästig – sie können die Lebensqualität stark beeinträchtigen und zu erheblichen Kosten im Gesundheitswesen führen (z. B. durch Arztbesuche, Medikamente und Arbeitsausfälle).
In diesem Blogartikel geben wir einen Überblick über die Häufigkeit von Allergien und Heuschnupfen in Deutschland, erklären Ursachen und Risikofaktoren, beschreiben typische Symptome und Auswirkungen und stellen sowohl schulmedizinische Behandlungsmöglichkeiten als auch alternative Ansätze vor. Abschließend geben wir Tipps zur Vorbeugung und Lebensführung [1,2,3].
Allergien in Deutschland – Zahlen und Trends
Allergien sind in den letzten Jahrzehnten immer häufiger geworden. Aktuell leidet fast ein Drittel der Erwachsenen innerhalb eines Jahres an mindestens einer allergischen Erkrankung. Frauen sind dabei etwas häufiger betroffen (rund 35 % der Frauen vs. 27 % der Männer). Deutschland liegt im europäischen Vergleich an der Spitze: In einer EU-weiten Befragung (EHIS) wiesen 15- bis 79-Jährige in Deutschland eine 12-Monats-Prävalenz von 29 % für Allergien auf – deutlich mehr als der EU-Durchschnitt von 17 %. Bei Kindern und Jugendlichen sind Allergien ebenfalls verbreitet, aber etwas seltener: Etwa 16 % der Unter-18-Jährigen haben eine zumindest eine der häufigsten allergischen Erkrankungen (Asthma, Heuschnupfen oder Neurodermitis). Bei Kindern wird die Rate für Heuschnupfen (Pollenallergie) aktuell mit rund 11 % angegeben (Lebenszeitprävalenz).
Auffällig ist, dass Allergien vor allem in jüngeren Altersgruppen auftreten: Im jungen und mittleren Erwachsenenalter berichten bis zu 40 % von Allergien, während in höheren Altersgruppen (Senioren) deutlich weniger betroffen sind. Dies könnte daran liegen, dass manche Allergien sich im Laufe des Lebens abschwächen oder ältere Generationen generell seltener Allergien entwickelt haben. Im Folgenden ist ein Graph, der die Prävalenz von Allergien in Deutschland nach Altersgruppen darstellt zu sehen. Er zeigt deutlich, dass jüngere Altersgruppen (insbesondere 18–44 Jahre) häufiger betroffen sind als ältere Menschen.
Bezüglich der Entwicklung über die Jahre zeigen Studien ein gemischtes Bild: Während Asthma bronchiale in Deutschland zwischen den 1990ern und 2010ern signifikant zugenommen hat (von ca. 5,7 % auf 8,6 % Lebenszeitprävalenz), ist die Häufigkeit von Heuschnupfen in diesem Zeitraum in etwa gleichgeblieben. Insgesamt scheinen Allergien sich auf einem hohen Niveau stabilisiert zu haben – allerdings sorgen Veränderungen der Umwelt (etwa durch Klimawandel) dafür, dass z. B. Pollenallergien früher im Jahr beginnen und länger andauern, was Betroffene stärker belastet. So blühen manche allergenen Pflanzen inzwischen länger, und neue Pflanzen wie die Ambrosia breiten sich aus. Allergien bleiben also ein wichtiges Thema für die öffentliche Gesundheit, und die Tendenz ist trotz leichter Plateau-Bildung weiterhin besorgniserregend hoch [2,4,5,6].
Formen von Allergien: Von Pollen bis Tierhaaren
Allergie ist nicht gleich Allergie – es gibt verschiedene Formen, je nachdem, welche Auslöser (Allergene) das Immunsystem fehlgeleitet aktivieren. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über wichtige Allergieformen, ihre typischen Auslöser und Symptome [7]:
Ursachen und Risikofaktoren
Warum manche Menschen Allergien entwickeln und andere nicht, ist bislang nicht vollständig geklärt. Eine entscheidende Rolle spielt jedoch die genetische Veranlagung: Kinder von Allergikern haben ein deutlich erhöhtes Risiko, selbst eine Allergie zu entwickeln – besonders, wenn beide Eltern betroffen sind. Diese sogenannte Atopie-Neigung führt dazu, dass das Immunsystem auf harmlose Substanzen mit einer übersteigerten IgE-Antikörper-Reaktion reagiert.
Neben der erblichen Veranlagung beeinflussen zahlreiche Umweltfaktoren das Allergierisiko. Luftverschmutzung, Passivrauchen, unausgewogene Ernährung, Vitamin-D-Mangel sowie schlechte Wohnverhältnisse mit Schimmel oder hoher Hausstaubbelastung können das Immunsystem aus dem Gleichgewicht bringen. Auch die Hygienehypothese spielt eine Rolle: Ein zu steriles Umfeld in der frühen Kindheit scheint das Immunsystem zu unterfordern, wodurch es später auf eigentlich harmlose Reize überreagiert. Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen oder früh Kontakt zu Gleichaltrigen haben, erkranken seltener. Der Klimawandel mit verlängerten Pollensaisons und neuen allergenen Pflanzenarten, ebenso wie frühkindliche Einflüsse wie Kaiserschnitt, fehlendes Stillen oder Antibiotikagabe, können die Darmflora stören – ein weniger vielfältiges Mikrobiom wird mit erhöhter Allergieneigung in Verbindung gebracht.
Insgesamt entsteht eine Allergie durch das Zusammenspiel von genetischer Disposition und Umwelt. Wenn beide Faktoren ungünstig zusammenkommen, kann das Immunsystem bei Kontakt mit einem harmlosen Stoff eine überschießende Reaktion entwickeln. Diese Sensibilisierung führt dazu, dass bei erneutem Kontakt Entzündungsbotenstoffe wie Histamin freigesetzt werden, die typische allergische Symptome verursachen. Warum dieses Gleichgewicht bei manchen Menschen kippt und bei anderen stabil bleibt, ist Gegenstand intensiver Forschung [6,8].
Symptome und Auswirkungen auf die Lebensqualität
Allergien können sehr unterschiedliche Beschwerden hervorrufen, je nachdem, welche Form vorliegt und welches Organ betroffen ist. Besonders bei sofortigen allergischen Reaktionen wie Heuschnupfen, Insektengift- oder Nahrungsmittelallergien treten typische Symptome auf, die durch die Ausschüttung von Histamin und anderen Entzündungsstoffen verursacht werden. Am häufigsten sind die Atemwege betroffen, etwa durch Niesanfälle, Fließschnupfen, Juckreiz oder Atemnot, aber auch die Augen, Haut, der Verdauungstrakt oder das Herz-Kreislauf-System können beteiligt sein. In schweren Fällen kann es zu einem anaphylaktischen Schock kommen, der eine sofortige Notfallbehandlung erfordert.
Oft treten die Symptome nicht isoliert auf, sondern in Kombination – etwa Heuschnupfen zusammen mit gereizten Augen oder Hautausschlägen mit Atemproblemen. Diese Beschwerden können den Alltag stark beeinträchtigen: Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Einschränkungen im Berufs- oder Schulleben sowie eine verminderte Lebensqualität sind häufige Folgen. Besonders bei Kindern können unbehandelte Allergien langfristig die Entwicklung und schulische Leistung negativ beeinflussen. Zudem bergen Allergien das Risiko chronischer Erkrankungen wie allergischem Asthma oder immer wiederkehrenden Entzündungen der Nebenhöhlen und Ohren.
Viele Betroffene erleben ihre Allergie als gravierende Einschränkung – sei es durch den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel, Haustiere oder Freizeitaktivitäten. Deshalb ist es wichtig, allergische Beschwerden ernst zu nehmen, frühzeitig ärztlich abklären zu lassen und gezielt zu behandeln. Das verbessert nicht nur die aktuelle Lebensqualität, sondern kann auch langfristige Komplikationen verhindern. Glücklicherweise stehen heute eine Vielzahl wirksamer Therapieoptionen zur Verfügung [1].
Schulmedizinische Behandlungsmöglichkeiten
Die schulmedizinische Behandlung von Allergien verfolgt zwei Hauptziele: akute Beschwerden zu lindern und die Allergieursache langfristig zu bekämpfen. Idealerweise werden beide Ansätze kombiniert und durch eine möglichst konsequente Vermeidung des jeweiligen Allergens ergänzt, etwa durch Pollenfilter, milbendichte Bettbezüge oder den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel. Da sich ein Kontakt mit Allergenen jedoch oft nicht vollständig vermeiden lässt, kommen verschiedene Therapieformen zum Einsatz.
Antihistaminika blockieren die Wirkung von Histamin, dem zentralen Botenstoff bei allergischen Reaktionen, und lindern Symptome wie Niesen, laufende Nase, juckende Augen oder Hautausschläge. Moderne Präparate wirken schnell, sind gut verträglich und machen kaum müde.
Glukokortikoide, also Kortisonpräparate, unterbrechen die Entzündungskaskade und gelten insbesondere lokal angewendet – etwa als Nasenspray, Inhalation oder Creme – als sehr wirksam bei mittleren bis starken Beschwerden. Systemisch verabreichtes Kortison wird nur bei schweren Fällen eingesetzt, da es stärkere Nebenwirkungen haben kann.
Die spezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) ist derzeit die einzige ursächliche Behandlungsmethode. Sie gewöhnt das Immunsystem über mehrere Jahre schrittweise an das Allergen, sodass die Reaktionen nachlassen. Besonders wirksam ist sie bei Pollen-, Milben- oder Insektengiftallergien.
Wenn herkömmliche Therapien nicht ausreichen, kommen Biologika zum Einsatz – moderne Antikörper, die gezielt in das Immunsystem eingreifen und beispielsweise IgE oder entzündungsfördernde Interleukine blockieren. Sie werden vor allem bei schwerem allergischem Asthma, Neurodermitis und chronischer Urtikaria eingesetzt, erfordern jedoch eine enge medizinische Betreuung.
Welche Therapie geeignet ist, hängt vom Typ der Allergie, der Ausprägung der Symptome und individuellen Faktoren ab. Oft empfiehlt sich eine Kombination verschiedener Maßnahmen, zum Beispiel Antihistaminikum und Kortison-Nasenspray in der Allergiesaison sowie begleitend eine Hyposensibilisierung. Auch die Schulung im Umgang mit Notfallmedikamenten wie Asthmasprays oder Adrenalinpens ist wichtig, um im Ernstfall richtig reagieren zu können [9,10,11].
Alternative und komplementäre Ansätze
Viele Allergiker suchen neben der schulmedizinischen Behandlung auch nach alternativen oder ergänzenden Therapien, um ihre Beschwerden besser zu bewältigen. Einige dieser komplementären Ansätze, wie etwa Akupunktur, zeigen in Studien positive Effekte, etwa eine Reduktion des Antihistaminika-Bedarfs und eine Verbesserung der Lebensqualität – auch wenn die genauen Wirkmechanismen noch nicht vollständig verstanden sind. Ähnliches gilt für pflanzliche Präparate aus der Phytotherapie, etwa Pestwurz oder Zitrusextrakte, die bei leichten Symptomen helfen können, jedoch nur ergänzend und nicht bei schweren Allergien eingesetzt werden sollten. Auch Probiotika, die das Darmmikrobiom positiv beeinflussen, werden zunehmend erforscht und zeigen erste vielversprechende Ergebnisse – eine flächendeckende Empfehlung steht jedoch noch aus.
Neben diesen gezielten Maßnahmen können auch ein gesunder Lebensstil und eine ausgewogene Ernährung das Immunsystem stärken. Eine mediterrane Kost, Stressreduktion und regelmäßige Bewegung tragen zur Stabilisierung der Abwehrkräfte bei. Ergänzende Atemtechniken, etwa bei allergischem Asthma, können das Wohlbefinden steigern, ersetzen jedoch keine medikamentöse Therapie. Insgesamt zeigt sich, dass ein ganzheitlicher Ansatz mit ergänzenden Methoden sinnvoll sein kann – jedoch immer in Kombination mit bewährter medizinischer Behandlung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alternative Therapien durchaus unterstützend wirken können, wenn sie seriös angewendet und ärztlich begleitet werden. Sie ersetzen die Schulmedizin nicht, sondern ergänzen sie sinnvoll. Wichtig ist dabei, auf glaubwürdige Quellen und wissenschaftlich fundierte Ansätze zu achten, anstatt vermeintliche Wundermittel zu vertrauen. Ziel bleibt es, die Allergie so gut zu kontrollieren, dass ein möglichst beschwerdefreier Alltag möglich ist [10,12,13,14,15].
Prävention und Tipps für Allergiker
Allergien lassen sich zwar nicht immer verhindern, doch es gibt wirksame Strategien zur Vorbeugung und Linderung. Die primäre Prävention beginnt bereits in der Schwangerschaft und im Säuglingsalter – etwa durch Rauchverzicht, Stillen und die frühe Einführung potenziell allergener Lebensmittel wie Ei oder Erdnuss, um eine Toleranz zu fördern. Ein gesunder Lebensstil, frische Luft und der Kontakt zu Gleichaltrigen stärken zusätzlich das Immunsystem. Die sekundäre Prävention richtet sich an Menschen mit bereits nachgewiesener Sensibilisierung, bei denen der Ausbruch der Allergie durch gezielte Allergenvermeidung verzögert werden soll. Tertiäre Prävention betrifft bereits erkrankte Allergiker und zielt darauf ab, Komplikationen wie Asthma zu verhindern – durch frühzeitige Behandlung, Immuntherapie und konsequente Alltagsmaßnahmen.
Im Alltag helfen gezielte Anpassungen: Pollenallergiker profitieren von Pollenschutzgittern und einem angepassten Lüftungsverhalten, Milbenallergiker von speziellen Bettbezügen und regelmäßiger Reinigung. Tierhaarallergien erfordern meist einen weitgehenden Verzicht auf Kontakt, bei Insektengiftallergien ist ein Notfallset unerlässlich. Wichtig sind außerdem ärztliche Betreuung, ein Allergiepass und gegebenenfalls eine konsequent durchgeführte Immuntherapie. Mit dem richtigen Umgang lassen sich Allergien heute gut kontrollieren – für mehr Lebensqualität und weniger gesundheitliche Risiken.
[6,9,7,16].
Quellen
- https://www.rki.de/DE/Themen/Nichtuebertragbare-Krankheiten/Koerperliche-Gesundheit/Allergien/allergien-node.html
- https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-908798
- https://www.springermedizin.de/atopische-dermatitis/asthma-bronchiale/aktueller-stand-zur-verbreitung-von-allergien-in-deutschland/9298826
- https://www.rki.de/DE/Aktuelles/Publikationen/Journal-of-Health-Monitoring/GBEDownloadsJ/Focus/JoHM_03_2021_GEDA_Gesundheitliche_Lage.pdf?__blob=publicationFile&v=1
- https://dserver.bundestag.de/btd/19/227/1922797.pdf#:~:text=Im%20Vergleich%20mit%20dem%20Bundesgesundheitssurvey,Nah%02rungsmittelallergien%20auf%20gleichem%20Niveau%20geblieben
- https://www.kinderaerzte-im-netz.de/krankheiten/allergien/ursachen/#:~:text=Bis%20heute%20weiß%20man%20nicht,Kinder%2C%20die%20auf%20Bauernhöfen%20oder
- https://www.daab.de/2024/05/die-10-haeufigsten-allergien-ursachen-symptome-und-tipps#:~:text=5
- https://www.daab.de/2024/06/zusammenhang-darmmikrobiom-und-heuschnupfen#:~:text=Die%20Ergebnisse%20deuten%20darauf%20hin%2C,Darmflora%20die%20allergische%20Sensibilisierung%20fördert
- https://www.allergieinformationsdienst.de/krankheitsbilder/heuschnupfen/behandlung#:~:text=Kurz%20erklärt
- https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/allergien-akupunktur-kann-heuschnupfen-lindern-1.1609564#:~:text=Akupunktur%20lindert%20die%20Beschwerden%20bei,225%2C%202103
- https://www.allergieinformationsdienst.de/therapie/allergie-medikamente/antikoerper-therapien#:~:text=Manche%20Antikörper,Mitteln%2C%20die%20auf%20–mab%20enden
- https://www.ikim.unibe.ch/forschung/factsheets/heuschnupfen_pflanzlich_und_nebenwirkungsarm__behandeln/index_ger.html#:~:text=Integrative%20Medizin%20,sicher%20und%20wurden%20gut%20vertragen
- https://www.ecarf.org/weniger-heuschnupfen-durch-probiotika/#:~:text=Probiotische%20Nahrungsergänzungsmittel%20können%20Heuschnupfen,Zentrums%20der%20Charité%20Berlin
- https://www.burgerstein-foundation.ch/de-DE/wissen/blog/pollenallergie-koennen-bakterien-und-mikronaehrstoffe-die-symptome-lindern#:~:text=Probiotika%20bei%20Pollenallergien%20helfen%20,zeigte%20sich%20eine%20starke
- https://www.allergieinformationsdienst.de/aktuelles/news/artikel/wie-wirksam-sind-atemuebungen-bei-asthma-bronchiale#:~:text=Das%20Cochrane,gewisse%20Verbesserung%20durch%20die%20Atemübungen
- https://www.allergieinformationsdienst.de/vorbeugung-und-schutz/allergien-vorbeugen#:~:text=Grundsätzlich%20lassen%20sich%20drei%20Formen,der%20Allergieprävention%20unterscheiden